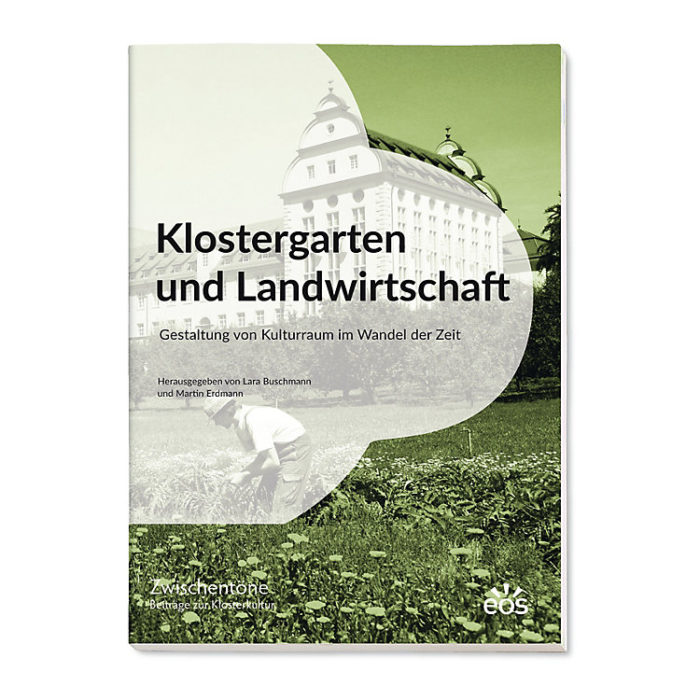Ein Rechtsbruch bereitet den Weg
Als Robert, erster Abt des Klosters Molesme, sein Kloster mit einer Gruppe von Unterstützern verließ, um in der Einsamkeit eines Feuchtgebietes am Fluss Saône, südlich von Dijon, ein Novum Monasterium zu gründen, beging er einen klaren Rechtsbruch. Nach der Regula Sancti Benedicti dürfte er weder sein Kloster noch sein Amt verlassen. Der Vorwurf des häretischen Vorgehens begleitete den Neuanfang, und tatsächlich musste Robert zurück in sein Kloster Molesme, wo er im Jahre 1111 verstarb.
Robert war ein eifriger Vertreter einer Gruppe von Mönchen, die zu einer ursprünglicheren Auslegung der Benediktusregel zurückkehren wollten. Er floh 1098 aus dem zu Reichtum gekommenen Molesme, um einen reformatorischen Neuanfang, der nichts anderes als eine Rückkehr zur angestrebten alten Regelbeachtung bedeuten sollte, zu wagen. Der Reichtum der Institution Kloster war in seinen Augen ein gefährlicher Irrweg, und eine Abkehr von der ursprünglichen Regel, die mit dem Namen Benedikts von Nursia verbunden ist. Die Frage der Reform war also eine Frage der Regelauslegung. Robert und seine Anhänger wollten zurück zur pura regula. Die propagandistisch formulierte Heiligkeit des Textes befreite die Nachfolger Roberts nicht von der Frage, was die reine Regel eigentlich bedeutete. In dem einzigen erhaltenen zisterziensischen Regelkommentar aus dem Kloster Pontigny aus dem Jahre 1210 wird diese Frage explizit aufgeworfen.[1]
Gegen den Vorwurf Ivos von Chartres († 1115) und anderer, die neue Gruppe lebe in eigenen, nicht öffentlichen und daher geheimen Orten nach eigenem Recht (in privatis locis proprio jure), sie seien fugitivi,[2] beharrten die Neuerer – mit Berufung auf das Decretum Gratiani Causa 19 quaestio 2 capitulum 2[3] – auf dem Vorrang der Entscheidung des Individuums (lex privata) gegenüber den allgemeinen Grundsätzen (lex publica), da es letztendlich um das Seelenheil des Einzelnen gehe. Gegen den erhobenen Häresieverdacht konnten die Zisterzienser erfolgreich anführen, dass sie nach der seit Jahrhunderten anerkannten Benediktusregel und eben nicht nach eigenem, selbst geschaffenem Recht leben wollten. Der dafür notwendige Bruch der Regel bedeutete aber, dass damit – natürlich unbewusst – der Startschuss zu einem bis dato größten Ordensverband mit völlig neuen administrativen Strukturen initiiert worden ist. Klöster neuen Typs entstanden, die in ambivalenter Form der Welt entfliehen wollten, aber dennoch in bisher nicht gekannter Weise mit dieser vernetzt waren und entsprechende Impulse aussendeten.
Wie könnte diese angedeutete neue Wirkmacht von Klöstern umschrieben werden? Darauf versucht Gert Melville eine Antwort zu geben.[4] Ausgehend von einer institutionell verankerten Macht, die im Kloster konsensual zwischen Abt und Konvent ausgeübt wurde, fußt diese auf dem grundsätzlichen Einigungswillen im Einzelkloster bzw. in einem Klosterverband auf dem Konsens aller beteiligten Klöster. Konsens als Machtfaktor bildete die Voraussetzung für den Transport von Prestige, Kompetenz und Ansehen nach außen hin, etwa durch konventual gelebte monastische Frömmigkeit oder gar durch individuelle Heiligkeit. Die damit im besten Falle erreichte Überzeugung der Laienwelt evozierte eine Wirkmacht nach außen, welche von jener nach innen hin zu unterscheiden ist. Der inquisitorischen Macht nach innen, gegenüber Konventsangehörigen, steht eine solche nach außen hin gegenüber: die Klöster konnten als Licht der Welt wahrgenommen werden.
Schöpferisches Potenzial
Diese Potenz kann nach Melville als Handlungs- und Gestaltungsmacht verstanden werden. Sie bildet das schöpferische Potential eines Klosters bzw. eines Ordens.[5] Dabei wird von zwei Innovationsvermutungen ausgegangen:
- Klöster und Orden haben ihre außerordentliche Festigkeit durch Leistungen mit hohen innovatorischen Potentialen, die sowohl nach innen wie nach außen hin wirken, fundiert.
- Die Wirkmacht der Klöster/Orden zeichnet sich durch ein Spektrum von gesellschaftlichen Interaktionen gegenüber dem weltlichen und kirchlichen Umfeld aus. Diese hat eine passive Komponente, um Einwirkungen von außen auf den Konvent abzufedern und damit den inneren Lebensformen gegebenenfalls anzupassen: Das einmal gewonnene Prestige eines Klosters etwa kann langlebiger als kurzfristige Einwirkungen bzw. Erschütterungen von außen sein. Die Wirkmacht besitzt darüber hinaus eine aktive Komponente, wenn die im Inneren erzeugten Kräfte über die Klostermauern hinweg die Umgebung umgestalten, sei es durch aktives Handeln oder durch Belehrung (Seelsorge, Predigt).
Somit wirken die Klöster als alternative Modelle sowohl mit Hilfe ihrer institutionellen Ordnungen als auch mit ihren medialen Kompetenzen und schließlich mit ihren gemeinschaftlichen Konzepten, die sich zu attraktiven Angeboten für das Außen transformieren können.
Schriftlichkeit und Institutionalisierung
Die Basis des Erfolges der Zisterzienser lag wohl zentral im konsequenten Einsatz von Schriftlichkeit. Da ein charismatischer Gründer fehlte, musste sich die neue Gruppe auf eine allseits akzeptierte normative Grundlage einigen, was zunächst auf der Basis der Carta caritatis geschah. Darin wurden das Verhältnis zwischen Cîteaux und seinen Tochterklöstern, die regelmäßige Visitation sowie der zwingende Besuch des Generalkapitels geregelt.[6]
Bei den Zisterziensern entstand ein transpersonaler Ordensverband – und das war neu – mit bisher unbekannten institutionellen Formen: mit einem Generalkapitel, fester Ordensprovinzialgliederung und regelmäßigen Visitationen. Dies führte – und das war erneut innovativ – zu einer versachlichten Ordensleitung. Der Orden hatte seine eigene Gesetzgebung, sein ius proprium, das in den Ordensstatuten grundgelegt wurde. Die Gesetzgebung lag in Händen des Generalkapitels. Letzteres war ein repräsentatives und auf Konsens ausgelegtes Entscheidungsorgan des Ordens. Die dort zusammentreffenden Äbte – unter der Leitung eines Generalabtes – konnten in allmählich sich herausbildenden förmlichen Rechtsverfahren zahllose ordensinterne Regelungen treffen. Mit dem Instrument der Visitation war eine Möglichkeit geschaffen, das klostereigene Recht vor Ort, d.h. in den einzelnen Klöstern, zu überwachen. Dieses permanente Bemühen um eine uniforme Ordnung (uniformitas) rieb sich aber an der realen Vielfältigkeit der weltlichen Gegebenheiten, ihrer diversitas.
Die von den innovativen Ordensstrukturen ausgehenden Veränderungen sollten sich bis in die heute akzeptierten europäischen weltlichen Regierungsformen bzw. Herrschaftsverfahren fortsetzen, nämlich in der selbstverständlichen Differenzierung zwischen Amt (Generalabt) und Person bzw. zwischen Kontroll- (Visitation) und Entscheidungsinstanzen (Generalkapitel). Dabei gelang es den Zisterziensern auch, ein erstes förmliches Steuerungsverfahren bei rechtlichen Fragen zu entwickeln, um damit eine im 12. und 13.
Jahrhundert einzigartige Nachhaltigkeit in der Entscheidungsfindung und -durchsetzung zu erreichen. Der schriftliche Niederschlag dieser ordensinternen förmlichen Verfahren hat sich bis in die Gegenwart durch die Statuten und deren Kommentare in seriellen Quellen erhalten. Förmliche Verfahren etwa zu Besitzstreitereien oder externen Übergriffen auf einzelklösterliche Rechte bedeuteten auch immer eine Herausforderung zur Reduktion der Komplexität der Einzelereignisse auf wenige Kardinalpunkte, um sie damit förmlich und effektiv entscheiden zu können. Dabei entstand am Anfang die inquisitorische Untersuchung des Einzelereignisses in den Visitationsprotokollen, dessen Ergebnis – unter Heranziehung von Zeugenbefragungen – dem Generalkapitel vorgelegt wurde. Dort wurde dann eine Entscheidung in Form von Definitionen (definitiones) gesucht, im Idealfalle ordensintern, aber bisweilen unter Anrufung von Päpsten, Königen und Fürsten. Durch diese Verfahrensroutine wurde nicht unwesentlich die Stabilität des Zisterzienserordens gewahrt.[7] Gleichzeitig wurde an die Welt signalisiert, dass jeder Angriff auf ein einzelnes Zisterzienserkloster eine Reaktion des Gesamtordens nach sich ziehen könnte.
Landwirtschaft und Infrastruktur
Neben diesen neuen institutionellen Formen sind mit den Zisterziensern – wie auch mit den zeitgleichen Prämonstratensern – neue innovative Wirtschaftsformen verbunden. Dabei zeigen sich erhebliche Unterschiede in der Umsetzung bei den Einzelklöstern, sobald man die normative Ebene wirtschaftlicher Vorgaben verlässt. Die Eigenbewirtschaftung der Ländereien durch Konversen[8] bedeutete, zumindest in der Frühphase, die Einführung neuer Bewirtschaftungsformen, welche zunächst nur noch bei den Prämonstratensern zu finden waren. Durch verstärkte Arrondierung von Grundbesitz strebte das Einzelkloster – in seiner jeweiligen singulären Lage – nach dem Aufbau eines zusammenhängenden Klosterbesitzes. Zugleich wurde eine neue Infrastruktur mit Versorgungszellen aufgebaut: Straßen als Verbindung zu den Absatzmärkten in den Städten, Mühlen als Maschinen zur Mechanisierung und Beschleunigung von Arbeitsabläufen, Dämme zum Schutz für landwirtschaftliche Anbauflächen vor Überschwemmung, Stadthöfe für die Direktvermarktung. Ein Zisterzienserkloster stand im engen Austausch mit der Welt, die Rückwendung an eine ursprüngliche Regel mit einem entsprechenden demütigen monastischen Leben schließt ein innovativ-positives Handeln in der Welt nicht aus.
Im Mittelpunkt standen große agrarische Einheiten wie Grangien (bei Prämonstratensern: Curiae), die eine effizientere Bewirtschaftung erlaubten und damit auch höhere Erträge, die neue Absatzformen wie die bereits erwähnten Stadthöfe eröffneten. Dort, direkt beim Konsumenten, konnte nun die Ware, unter Ausschaltung eines Zwischenhandels, verkauft werden. Das bedeutete aber auch, dass beide Orden auf die Stadtgründungswelle des 12. und 13. Jahrhunderts reagierten. Klöster sind also, trotz der Suche nach der Weltabgeschiedenheit, immer mit der Welt verbunden. Die Anlagestrategien von Klöstern bevorzugten die Nähe von Gewässern, nicht nur um frisches Wasser zu haben, sondern auch um die Maschinen des Mittelalters, die Mühlen, effektiv einzusetzen. Anbau, Vertrieb und Absatz zeigten also Ansätze protoindustrieller Strukturen. Diese Bewirtschaftung funktionierte nur so lange, wie innerklösterliche Bearbeiter, die bereits erwähnten Konversen, die Landwirtschaft übernahmen. Trotz aller normativer Aussagen waren es nicht die Zisterziensermönche selbst, die arbeiteten: sie ließen in vielen Fällen arbeiten.
Macht und Maßlosigkeit
Einzelne Zisterzienser wie Prämonstratenser traten als Wirtschaftsmanager auf, welche die Großbetriebe der Grangien leiteten und dabei so erfolgreich sein konnten, dass ihre Oberen die Notbremse zogen und sie, um ihr Seelenheil besorgt, für andere Aufgaben einsetzten. In Caesarius von Heisterbachs (1180 bis 1240) Dialogus Miraculorum wird von einem Steinfelder Abt berichtet, der einen sehr tüchtigen Konversen als Leiter eines klostereigenen Wirtschaftshofs besaß.[9] Dieser vermehrte beständig die Besitzungen und verwaltete die Ländereien tadellos, wobei er stets danach trachtete, möglichst hohe Erträge und Gewinne zu erzielen. Dieses für uns Heutige durchaus nachvollziehbare Verhalten führte in der Erzählung des beginnenden 13. Jahrhunderts zu einer völlig anderen Bewertung: Trotz des Protestes der Mitbrüder entsetzte der Abt diesen in unseren Augen tüchtigen Wirtschaftsleiter von seinem Amt, da er ihm Geiz und Maßlosigkeit vorwarf. Der Wirtschaftsleiter war kein Mönch, sondern ein Konverse des Klosters, d.h. er lebte außerhalb des Konventes in einem anderen Klosterbereich – noch heute sichtbar beispielsweise in Chorin – mit anderen ein ebenfalls gewissen religiösen Normen unterworfenes Leben, blieb aber in einer Zwischenstellung zwischen Laien- und Mönchsstand, die ihm erlaubte, in der Welt für das Stift bzw. Kloster zu arbeiten. Der Propst rechtfertigte seine Maßnahme mit dem Schutz des Seelenheils des Konversen, für das er mitverantwortlich wäre. Als der Kölner Erzbischof denselben Konversen, wohl ein besonders herausragender Verwaltungsfachmann und Ökonom, zur Reformierung für einige desolate erzbischöfliche Wirtschaftshöfe aus Steinfeld ‚ausleihen’ wollte, lehnte der Propst konsequenterweise ab.[10] Die „kapitalistische Wirtschaftsgesinnung“ hatte zumindest für ihn eine Grenze in der Bewahrung des Seelenheils – aber interessanterweise nicht mehr für alle seiner Zeitgenossen! Ein neues Denken im ökonomischen Sektor machte sich in Europa breit, Zisterzienser wie Prämonstratenser wirkten dabei mit!
Der erwähnte Auszug aus dem Dialogus wie auch die zisterziensischen Generalkapitelsstatuten oder Autoren wie Stephan von Tournai (1128-1203) bzw. Giraldus Cambrensis (ca. 1146-1223) geben dazu höchst informative Einblicke.[11] Die intensiven Landkäufe sowie der Tausch von Ländereien, ferner die Ablösung von fremden Grundlasten und Herrschaftsrechten sowie die planmäßige Wüstung von ‚ungünstig‘ gelegenen Ortschaften auf Kosten der dortigen Bewohner wurden kritisiert.[12] Das aus einer rigoristischen Askese heraus gebildete Arbeits- und Leistungsethos scheint sein irdisches Ziel in einer Akkumulation von Besitzgütern für das Kloster gesehen zu haben. Hier wäre eine erstaunliche Spannung von scheinbar Gegensätzlichem sichtbar!
Zisterzienserklöster nutzten die städtische Geldwirtschaft und – dies zeigen englische Beispiele – machten Termingeschäfte, indem sie bei Wolle auf eine zukünftige Erhöhung des Preises wetteten und in diesem Zusammenhang auch Kredite vergaben. Somit kam es zu einer Einkommensoptimierung, ferner einer Intensitäts- und Qualitätssteigerung unter verstärkter Einbeziehung einer genauen Buchführung. Dies sind ökonomische Gegebenheiten, die heute gang und gäbe sind, deren Wurzeln aber kaum in klösterlichen Wirtschaftsstrukturen des 12. und 13. Jahrhunderts gesucht werden würden.[13]
Die weite Verbreitung zisterziensischer Klöster wurde auf der Basis eines ausgeklügelten Netzwerkes mit Adeligen und Bürgern erzielt. Die Ministerialen der babenbergischen Markgrafen und Herzöge von Österreich etwa, die Kuenringer, bauten so um Wien herum einen großen Verbund von Zisterzienserklöstern auf, der dem Landesausbau entscheidende Impulse gab. Persönliche Bindungen und Gemeinschaftsvorstellungen sind weitere wirkmächtige Angebote von monastischen Institutionen.[14] Exemplarisch zeigt sich dies beim Aufbau einer zisterziensischen Klosterlandschaft in Österreich, die 1133 mit der Gründung Heiligenkreuz begann und sich 1138 mit Zwettl fortsetzte. Im Zwettler Liber fundatorum aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts wird in einer modellhaften Form die entstandene Klosterlandschaft idealtypisch uminterpretiert und graphisch dargestellt.[15] Durch die beteiligten adeligen wir bürgerlichen Stifterfamilien entstand ein gesellschaftliches Netzwerk von Förderern, die das politische Überleben der Klöster sicherten.
Eine vergleichbare Wechselwirkung zwischen Innen und Außen, zwischen monastischer Spiritualität und personalen Netzwerken, zeigt sich bei dem ältesten Zisterzienserkloster östlich des Rheins, in dem 1127 gegründeten Ebrach, das für den Ausbau des Steigerwaldgebietes wertvolle Arbeit leistete. Und auch Bronnbach, 1151 gegründet,[16] hat für den Ausbau der Kulturlandschaft im Taubergebiet Erhebliches geleistet. Freilich erforderte dies immer ein intensives Kontaktfeld mit der Umgebung. Geistliche Institutionen hatten aber nicht nur Einfluss auf die urbane und städtische Entwicklung, sondern auch auf das Land. Die räumliche Ausdehnung von Herrschaft prägt die Kulturlandschaft bis heute. Landschaft wird als vom Menschen veränderbar und bis in das 18. Jahrhundert hinein als ausnutzbar betrachtet. Der Wald hat keine romantische Erholungsbedeutung, sondern ist ökonomisch einsetzbar, um Nachfragen bis zu weit entfernten Märkten zu befriedigen, die Wiesen dienten für die Viehzucht, die Gewässer für den Fisch- und Krebsfang.
Europäisches Handeln und regionale Abhängigkeit
So entstand letztlich ein europaweites Netz, so dass bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts über 340 Zisterzen zu finden sind.[17] Diese Weite war jedoch von den Gegebenheiten der unmittelbaren Umgebung immer wieder gefährdet, so dass jedes Einzelkloster in einem sich ständig verändernden Spannungsfeld zwischen Region, Diözese und Ordensprovinz lag, oder anders ausgedrückt, zwischen Generalkapitel, Diözesanbischof und benachbarten Adeligen, die eine Zisterze in vielfältiger Weise nützen wollten, sei es als Grablege, als Ort für Stiftungen oder als Bereich der gewalttätigen Bereicherung. Die Geschichte Bronnbachs zeigt dies beispielhaft und nachdrücklich.
Im Kampf zwischen der vom Gesamtverband erstrebten uniformitas mit der regionalspezifischen diversitas gab sich der Orden eine Form eigener europäischer Identität. Damit standen zugleich Norm und Realität im Spannungsverhältnis von Kontinuität und Wandel. Dieses zeigt sich erneut auch an Bronnbach, denn die Zahl der nachweisbaren Generalkapitelsbesuche ist beispielsweise sehr gering. Die Norm der regelmäßig geforderten Generalkapitelsreise stand der Realität der jeweiligen Zeitströme entgegen, die genau solche verhinderten.
Ein sichtbares und zugleich zusammenfassendes Symbol war das Ordenswappen der Zisterzienser, ein geschachteter Schräglinksbalken. Diese Einheitlichkeit wird jedoch recht bald durch klosterindividuelle Zusätze verändert: in Bronnbach war es die hl. Maria und eine aufflatternde Lerche, die den Platz des Klosters angezeigt haben soll.
Die neuen Kommunikationsstrukturen sowie deren Träger ermöglichten einerseits eine neue zusammenfassende Sicht auf den Orden und seine Glieder. Dabei zeigen sich andererseits Brechungen mit anderen, älteren kirchlichen Raumerfassungen, denn Ordensgliederung und Diözese standen in der Regel in einem schwer aufzuhebenden Spannungsverhältnis.
Eine neu gegründete Zisterze hat eine besondere Bindung zum Herkunftsort seines Gründungskonventes, der meist aus einem älteren Zisterzienserkloster kam. Letztlich wurde damit eine Abstammungskette (linea) bis hin zu den vier von Cîteaux direkt gegründeten großen zisterziensischen Gründungsabteien Morimond, Clairvaux, Pontigny und La Ferté konstruiert und schriftlich festgehalten. Diese Abhängigkeit stand im ständigen Kontrast zu den Bindungen der einzelnen Zisterzen zu ihrer direkten politischen wie sozialen Umgebung. In Bronnbach wird die Situation in der Anfangszeit zudem verkompliziert, weil der Gründungskonvent nicht aus der Mutterabtei Maulbronn, sondern aus Waldsassen kam. Dies wird damit begründet, dass das ebenfalls erst kurz vor Bronnbach gegründete Kloster Maulbronn wegen Mangel an Mönchen keinen Gründungskonvent abstellen konnte. Trotz dieses anfänglichen Mankos konnte sich Maulbronn letztlich gegenüber Waldsassen durchsetzen. So lautete die offizielle linea für Bronnbach: Cîteaux – Morimond – Bellevaux – Lützel – Neuburg – Maulbronn.[18]
Auch wenn der Zisterzienserorden ein europaweit agierender Klosterverband war, so mussten die einzelnen Klöster mit den politischen, rechtlichen und sozialen Bedingungen ihrer Umgebung zurechtkommen. Damit kamen sie aber auch in andere Kommunikationsnetze, in denen sie sich zu bewähren hatten.
Bronnbach war zugleich ein heiß umstrittener Ort der Herrschaft für die Hochstifte und Bistümer Mainz, Würzburg sowie der Grafschaft Wertheim. Bereits bei der Gründung hat das Erzstift mit seinem Erzbischof Arnold (1153-1160) vielfältig Einfluss genommen, Würzburg dagegen beanspruchte für sich – sicher seit etwa 1180[19] –, der oberste Ordinarius über Bronnbach zu sein und die Grafen von Wertheim handelten seit den 1350er Jahren als Schutzherren des Klosters. Und auch das staufische Königtum versuchte mit dem Kloster seinen Einfluss im Main-Tauber-Raum zu vergrößern.[20]
Die Geschichte Bronnbachs wurde an anderer Stelle bereits ausführlich geschildert.[21] Die Ausführungen können jedoch zeigen, dass die zisterziensische Norm wesentliche Innovationen in den Bereichen Regierungsformen und Wirtschaftssysteme vorausdachte, die durch die europaweite Verbreitung des Ordens eben auch das abendländische Europa insgesamt mitprägten. Auf der anderen Seite war die einzelne Zisterze in der lebensweltlichen Praxis immer von ihrer unmittelbaren Umgebung geprägt. Diese Spannung macht die einzigartige Geschichte des Gesamtordens wie auch des Einzelklosters aus. Gleichzeitig brachte sie einen europaweit spürbaren Innovationsschub in ökonomischen wie administrativen Bereichen, womit die Wirkmächtigkeit von Klöstern eindrucksvoll bestätigt wäre.